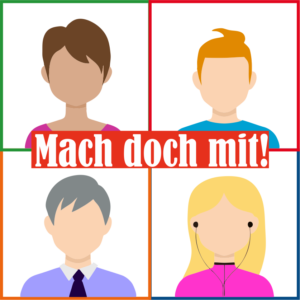Aktuelles
Obstbaumschnitt auf Peter-Rickmers-Wiese
/in Aktuelles /von Silke Depker
Initiativgruppe BENE lädt ein zu Gemeinschaftsaktion im Kurpark
Die Initiativgruppe BENE (Bad Essen Nachhaltig Entwickeln) lädt alle Interessierten herzlichst ein, aktiv an einer Gemeinschaftsaktion mitzuwirken! Nach einem erfolgreichen ersten Schnitttermin Anfang Februar sollen nun in einer 2. Aktion die Obstbäume auf Peter-Rickmers-Wiese im Bad Essener Kurpark wieder fit für das Frühjahr gemacht werden. Astwerk schneiden, Baumschnitt einsammeln und wegtragen – es gibt viel zu tun und jede helfende Hand ist gefragt.
Die kleine „Mundraub“- und Obstbaumwiese mit Apfelbäumen liegt am Rande des westlichen Teils des Bad Essener Kurparks inmitten der Peter-Rickmers-Wiese. Dieser sehr naturbelassene Teil des Bad Essener Kurparks befindet sich oberhalb der Straße “Auf der Breede” und westlich der Bergstraße. Hier wurde der alte Baumbestand aus den 50ern im Jahre 2013 durch weitere Apfelbäume ergänzt. Damit die Bäume Früchte tragen, müssen diese im Frühjahr regelmäßig beschnitten werden.
Die Baumschnittaktion findet statt am Samstag, den 24. Februar 2024 um 14 Uhr. Mitzubringen sind neben Obstbaumschnitt auf Peter-Rickmers-Wiese guter Laune robuste Kleidung, Gartenhandschuhe und wer hat: Gartenschere, Astschere, Gartenabfallsäcke, Leiter etc. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.
Vortrag: Wildbienen und der Bau von Nisthilfen für Insekten
/in Aktuelles /von Silke DepkerIn Zusammenarbeit mit den Verschönerungsverein Bad Essen, Hüsede und Eielstädt laden wir herzlich zu einem interessanten und interaktiven Vortrag rund um das Thema “Wildbienen und der Bau von Nisthilfen” (auch Bienen- oder Insektenhotels genannt) ein.
Wildbienen sind vielfach vom Aussterben bedroht. Die Gründe dafür sind fehlende Naturräume und die entsprechenden Nahrungspflanzen. Nisthilfen für Insekten können einen Beitrag dazu leisten, die Lebensweise der Wildbienen zu beobachten und zu verstehen. Dies fördert allgemein das Verständnis der Zusammenhänge in der Natur.
Ziel dieser Veranstaltung ist die Vermittlung von Grundlagenwissen über Wildbienen und deren Lebensweise sowie den Bau von professionellen Nisthilfen für Insekten.
Dr. Holger Brüggemann, Biologe mit Leidenschaft für unsere Fauna und Flora, besitzt seit mehreren Jahren eine große, komplett selbst angefertigte, Nisthilfe für Wildbienen. Die Nisthilfen, die im Handel angeboten werden, sind meistens von schlechter Qualität. Daher möchte er sein Wissen weitergeben, um Fehler beim Selbstbau zu vermeiden.
Wie macht man es richtig? Was kann man falsch machen? Das werden Fragen sein, mit denen man sich an diesem Tag beschäftigen wird. Materialien für den Bau der Nisthilfen können vor Ort besichtigt werden. Außerdem gibt es Informationen zu Literatur und Bezugsquellen für geeignete Materialien.
Diese Veranstaltung kann zukünftig als Grundlage zur Durchführung von Workshops oder anderer Angebote im Bereich der Planung und dem Bau von Nisthilfen für Insekten dienen. Zielgruppen können dabei Vereine, Ortschaften oder auch Privathaushalte sein. Bei
Interesse steht der Verschönerungsverein Bad Essen e. V. und die Initiativgruppe BENE einer Zusammenarbeit offen gegenüber.
➡️Ort: TriO, Bad Essen, Schulallee 2
➡️Termin: Samstag, 10.02.2024 von 10:00-12:00 Uhr
➡️Kosten: gratis
📝Anmeldung/Koordination: Ines Schobert, Verschönerungsverein Bad Essen e.V. TEL. 0179-3906683
Bad Essen lädt ein: Wie kann kommunale Nachhaltigkeit in der Gemeinde gelingen
/in Aktuelles, News, Politik in Bad Essen /von Silke Depker“Zukunftsfähiges Handeln verspricht eine lebenswerte Gemeinde für alle. Unser Lebensumfeld für die Zukunft zu rüsten und für nachfolgende Generationen attraktiv zu gestalten, kann nur gemeinsam gelingen. Was kann jede und jeder einzelne von uns dafür tun? Welche Initiativen und Projekte gibt es bereits vor Ort?” Darum wird es in einer Auftaktveranstaltung gehen, zu der die Gemeinde Bad Essen alle interessierten Bürgerinnen und Bürger einlädt. Denn der Frage, wie kommunale Nachhaltigkeit bei uns vor Ort gelingen kann, wird sich unsere Gemeinde in den kommenden Monaten stellen wollen.
Die Veranstaltung findet im Rahmen des Projektes „Kommunale Nachhaltigkeit für kleine und mittlere Kommunen in Niedersachsen“ statt, durchgeführt von der Kommunalen Umwelt-AktioN UAN und gefördert durch das Land Niedersachsen. Weitere Informationen unter: www.uan.de
Die Auftaktinformationsveranstaltung hat das Ziel, interessierte Bürgerinnen und Bürger für das Thema Nachhaltigkeit zu sensibilisieren, über das Projekt KommN Niedersachsen der UAN zu informieren und eine 15-20-köpfige, vielfältige Arbeitsgruppe zu gründen. Diese Arbeitsgruppe wird sich dann in den kommenden Monaten damit beschäftigen, Themenschwerpunkte zu erarbeiten und eine kommunale Nachhaltigkeitsstrategie mit Zielvereinbarungen zu entwickeln.
Themenschwerpunkte für die Arbeitsgemeinschaft werden Klima und Energie, Natürliche Ressourcen und Umwelt, Arbeit und Wirtschaft, Mobilität, Wohlbefinden, Demografie, Gesellschaftliche Teilhabe & Gender, Bildung sowie Kooperationen und Globale Verantwortung sein.
Die Auftaktveranstaltung findet am Donnerstag, den 25. 01.2024 um 18.30 Uhr in der Aula der Oberschule in Bad Essen, Platanenallee 5-7 statt. Die Teilnahme ist kostenfrei.
Angebot auf dem Bad Essener Wochenmarkt: Die Moorkiefer als ökologischer Weihnachtsbaum
/in Aktuelles, Allgemein /von Silke DepkerDie Moorkiefer als ökologischer Weihnachtsbaum ist eine großartige Alternative zum herkömmlichen Weihnachtsbaum. Der NABU Osnabrück engagiert sich seit vielen Jahren für die Renaturierung im Venner Moor und hält dort degenerierte Moorflächen von Baumbewuchs frei, um das Gebiet wieder in einen naturnahen Zustand zu bringen. Die Bäume, die entfernt werden müssen, bestehen hauptsächlich aus Birken, Traubenkirschen, Faulbaum und Kiefern. Anstatt diese Bäume zu kompostieren oder als Brennholz zu nutzen, bietet die Zwischennutzung als Weihnachtsbaum eine sinnvolle Alternative.
Die Ökobilanz der Weihnachtskiefern ist im Vergleich zur klassischen Nordmanntanne unschlagbar. Es gibt keine weiten Transportwege, keinen Pestizideinsatz und keinen Flächenverbrauch. Die Moorkiefer bietet ausreichend Platz für Schmuck und Dekoration und nadelt nicht.
Die örtliche Initiative BENE (Bad Essen Nachhaltig Entwickeln) gibt in Zusammenarbeit mit dem NABU die aus dem Venner Moor stammenden Kiefern auf dem Bad Essener Wochenmarkt am
7. + 14. Dezember 2023 von 14 und 18 Uhr
gegen eine Spende ab.
Über BENE
BENE ist eine offene und überparteiliche Initiativgruppe, die das Ziel hat, Menschen zu motivieren, sich aktiv in der Gemeinde Bad Essen für nachhaltige Projekte einzusetzen. Die Grundlage stellen die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (UN). Einen großen Wert legt BENE auf lokale Themen. Im Fokus stehen neben der Umsetzung von Projekten die Vernetzung und Diskussion – gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern, offenen Gruppen, Arbeitskreisen, der Politik und Vereinen.
Über den NABU Osnabrück e.V.
Wir sind Naturschutzmacher. Ob Entkusselung der Moore, Demonstrieren gegen neue Fernstraßen oder Bauen von Nistkästen. Wir nehmen den Spaten in die Hand und arbeiten für die Natur. Dabei ist uns nicht nur der Erhalt der Natur wichtig, sondern auch das Leben mit ihr. So sind wir neben dem praktischen Naturschutz auch politisch und sozial aktiv und wollen damit unseren Teil zum Schutz der Natur beitragen.
Ein naturnaher Garten als Lebensraum
/in Aktuelles /von Silke Depkervon Dr. Birgit ten Thoren, Bad Essen
Der Erhalt und die Förderung der Biodiversität ist nicht zuletzt seit Bekanntwerden des Insektensterbens eines der wichtigen Themen der heutigen Zeit. Der Verlust der Biodiversität muss jedem Menschen auffallen, der in seiner Kindheit noch blühende Wiesen und Wegraine, Obstbaumwiesen oder singende Feldlerchen erleben konnte.
Zeichen der Zeit: Verlust der Biodiversität
Wie dem Artenverlust entgegengesteuert werden kann, ist weitgehend bekannt. Von besonderer Wirksamkeit ist die Verringerung der Nährstoffeinträge und der Pestizidfracht in die Landschaft. In den vergangenen 30-40 Jahren kam es zur überhöhten Zufuhr von Nährstoffen, was einen starken Verlust von Arten nach sich zog. Dagegen zeigen die Ergebnisse von 98 ausgewerteten Studien zur Biodiversität, dass die ökologische Landwirtschaft eine wichtige Rolle gegen den Rückgang der Artenvielfalt spielen kann[1]. Demgegenüber hat neben der Intensivierung der Flächennutzung in der Landschaft besonders der hohe Versiegelungsgrad im Zuge der Urbanisierung Folgen für die Biodiversität und für unser Klima.
Auf versiegelten Flächen kann Regenwasser nicht versickern, es kommt zu oberflächlicher Abschwemmung bzw. es wird der Kanalisation zugeführt. Allerdings kann dies bei extremen Wetterbedingungen wie Starkregen zu Problemen führen: das anfallende Wasser kann nicht schnell genug abgeführt werden und es kommt zu Hochwasserereignissen, zum Überlauf von – zumeist begradigten – Fließgewässern und der Kanalisation.
Demgegenüber kann Regen auf lockerem, unversiegelten Boden versickern und im Wurzelraum im Boden gehalten werden. Die Wasserbindungsfähigkeit ist unterschiedlich stark ausgeprägt und hängt vor allem auch von der Beschaffenheit des Bodens ab.
Ein feuchter lockerer, nicht verfestigter Boden bietet seinen natürlichen Bewohnern Lebensraum. Hier finden sich Maulwürfe, Schnecken, Schnakenlarven, Engerlinge und weitere Arten. Ein Maulwurf findet hier Regenwürmer und Raupen, ein Zeichen dafür, dass der Boden gesund und gut durchlüftet ist. Ein lockerer Boden bildet die Voraussetzung für gutes Pflanzenwachstum.
Schutz von Arten und Lebensgemeinschaften auf politischer Ebene
Zum Schutz von Arten und Lebensräumen sind Schutzgebiete eingerichtet worden. Dabei sichern Schutzgebietsverordnungen die Erhaltung von Schutzzielen. Diese definieren sich durch Erhalt bestimmter Habitateigenschaften und Sicherung der Vorkommen bestandsbedrohter Tier- und Pflanzenarten. Doch gegenüber diesen eher großräumigen Maßnahmen ist es besonders wichtig, in der Landschaft Korridore zu erhalten, oder neu anzulegen, die als Biotopverbund den genetischen Austausch von Arten und Populationen gewährleisten helfen.
Insofern ist die verbindende Wirkung landschaftsprägender Elemente als Biotopverbund bzw. in ihrer Funktion als Trittsteinbiotop in Form von Waldbereichen, Hecken, Saumhabitaten und Gewässern elementar, um den Verlust der Artenvielfalt aufzuhalten.
Zusätzlich kann aber auch im kleinen Maßstab Gutes bewirkt werden. Menschen mit einem eigenen Garten beispielsweise können überlegen, wie der eigene Garten als vielfältiger Lebensraum gestaltet werden kann.
Verantwortung leben
Aus Gründen des Boden-, Arten- und Klimaschutzes sollten wir im Garten auf Versiegelung, Kies- und Folienbeete verzichten. Aus biologischer Sicht gelten sie als tot, Regenwasser kann hier nicht versickern, ein gesundes Bodenleben sich nicht entwickeln. Zudem heizen sich versiegelte Flächen stark auf.
In einem naturnahen Garten können Kinder Insekten erleben, ein singendes Rotkehlchen im Gebüsch entdecken und der Amsel beim Durchwühlen der Laubschicht oder bei der Suche nach Regenwürmern zuschauen. Ein lebendiger Garten ist ein reicher Garten, in dem sich Lebenskreisläufe im kleinen Kosmos zeigen. Einfach und unkompliziert lässt sich hier ein Verständnis für natürliche Abläufe wecken. Ohne diesen natürlichen Kreislauf ist Leben nicht denkbar.
Einheimische Bäume und Sträucher
Sehr wichtige Elemente in einem natürlichen Garten nehmen einheimische Bäume und Sträucher ein.
Vor allem alte Bäume wirken klimatisch ausgleichend, sie liefern Sauerstoff, bieten Schatten, binden Wasser in Blattwerk und Wurzelraum. Eiche, Buche, Feldahorn beispielsweise liefern wertvollen Lebensraum für Vögel und Insekten. Welcher Baum in den Garten passt, sollte allerdings überlegt sein, denn die genannten Bäume können über 25 m hoch werden, was für einen kleinen Garten möglicherweise zu groß sein kann. Nicht so hoch wachsen typische Heckengehölze, die zudem auch einen Schnitt gut vertragen.
Heimische Sträucher sind wie die genannten Bäume für Vogel- und Insekten von hohem Wert. Dies haben sie insbesondere, wenn sie nicht geschnitten werden. Bei freiem Heckenwuchs kann sich sowohl Blüte als auch Frucht entfalten und birgt neben dem Schutz auch viel Nahrung für Insekten und Vögel. Die Früchte des Weißdorns werden von über 30 heimischen Vogelarten verzehrt. In diesen Sträuchern nisten Gebüschbrüter wie die Heckenbraunelle, die mit ihrem früh im Jahr einsetzenden Gesang den Frühling ankündigt. Wertvolle einheimische Sträucher, die Schutz und Nahrung für Vögel und Insekten gleichermaßen bieten, sind Faulbaum, Felsenbirne, Holunder, Liguster, Pfaffenhütchen, Kreuz- und Weißdorn (dornig), Hundsrose und weitere. Beim Kauf im Fachhandel sollte man nachfragen, ob die Art einheimisch ist und wann Blüte und Reifezeit der Früchte ist. So lässt sich eine Gartenhecke vielgestaltig und naturschutzfachlich wertvoll gestalten. Zu beachten ist bei einer Hecke, dass mit der Höhe und Breite auch die Qualität als Lebensraum zunimmt.
Obstbäume, insbesondere Apfelbäume entwickeln nach ein paar Jahren Faulstellen mit Rissen oder Höhlen, in die Vögel oder andere Arten einziehen können. Der Gartenrotschwanz mag Obstbaumwiesen. Standortheimische Gehölze liefern die Insektennahrung gleich mit: zur Blütezeit werden viele Wildbienen und Bienen angelockt. Mit ihrer Bestäubungsleistung sorgen sie dafür, dass im Spätsommer und im Herbst die Früchte heranreifen. Auch diese können von Insekten und ihren Larven bewohnt werden.
Wer einem Nützling im Garten helfen will, hängt Blumentöpfe aus Ton verkehrt herum und mit Stroh vollgestopft in den Apfelbaum. Es ist hilfreich, auch ein Drahtgitter anzubringen, damit das Stroh nicht herausfällt. Hierhin ziehen sich Ohrenkrabbler gern zurück. Sie erledigen nutzbringende Dienste, denn sie fressen gern Blattläuse.
Nisthilfen für Vögel
In große alte Bäume wie Buche, Hainbuche, Feldahorn oder Eiche als auch in Obstbäume kann man Nisthilfen hängen. Besonders beliebt sind Meisenkästen, aber auch andere Arten können als Höhlenbrüter einen artgerechten Kasten beziehen. Dazu gehört auch der Star. Die Aufhängung eines Nistkastens sollte möglichst mit Aluminiumnägeln erfolgen, um den Stamm nicht zu schädigen. Oder man hilft sich mit einem Kunststoff ummantelten Metallbügel, der an einem Ast möglichst stammnah gehängt wird. Informationen zum Selberbau und Kauf liefert der NABU. Zudem finden sich im Handel artgerechte Nisthilfen unter www.der-natur-shop.de oder auch www.schwegler-shop.de. Bei der Anbringung sind die richtige Höhe (mindestens 3 m) sowie die richtige Ausrichtung zum Schutz vor zu starker Sonneneinstrahlung nach Nord/ Nordost von Bedeutung.
Gebäudebrüter unterstützen
Durch Haussanierungen und energetisch wirksame Abdichtungen im Dach- und Traufbereich gehen oftmals Nistplätze von Vögeln oder Fledermausquartiere verloren. Aus Artenschutzgründen ist es verboten, diese Fortpflanzungsstätten zu beseitigen. Bei Neubauten werden in der Regel die Ansprüche von Gebäude bewohnenden Tierarten nicht berücksichtigt. Doch auch hier trägt der Mensch Verantwortung und hat es in der Hand, Haussperlingen, Mehlschwalben und Mauerseglern einen Nistplatz zu garantieren. Dabei sind im Handel (s.o.) für den Neubau mittlerweile Hohlblocksteine erhältlich, in die Gebäude bewohnende Tierarten, zu denen auch Fledermäuse gehören, einziehen können.
Wer Vögeln wie Haussperlingen Nisthilfen am Haus anbieten möchte, oder auch Unterschlupf für Fledermäuse schaffen will, findet eine Auswahl unter den genannten Adressen. Wichtig ist auf Beschattung, freien Anflug und geringe Sonneneinstrahlung zu achten.
An hohen Häusern nach Nord/ Nordost können auch Nisthilfen für Mauersegler (mindestens sechs Meter hoch) angebracht werden. Sie benötigen vor allem freien Anflug und Schutz vor zu starker Besonnung. Beim Ansiedeln hilft es, die arteigenen Rufe zur Ankunftszeit der Mauersegler in den frühen Abendstunden für eine Zeit abzuspielen. Die Ansiedlung von Mehlschwalben kann vor allem dann gelingen, wenn das Haus zuvor von ein bis zwei Paaren besiedelt war. Beide Arten bieten im Sommer ein faszinierendes Schauspiel bei ihrer Luftjagd nach Insekten. Die Mauersegler liefern bei ihren allabendlichen besonders rasanten Flügen, begleitet von intensivem Rufen ein echtes Spektakel. Gegen die dauerhafte Verschmutzung der Hauswand hilft es, im Herbst nach Abflug der Weitstreckenzieher die Hauswand kurz mit einem Wasserschlauch abzuspritzen.
Weniger ist mehr
Wenn Sie besonders ordentlich sind, können Sie im Hinblick auf eine ökologische Gartenbereicherung vielleicht mit einer kleinen Ecke anfangen, die Sie sich selbst überlassen. Hier lassen Sie das Laub liegen, packen vielleicht noch ein paar abgeschnittene Äste dazu und vergessen diese Gartenecke. Nicht nur Igel, Amsel, Zaunkönig werden diesen Platz bevorzugen, wer weiß, vielleicht entdecken Sie noch andere Gartenbewohner.
Stängel von Stauden bleiben bis zum Frühjahr stehen. Die trockenen Halme können im Winter ihren eigenen Reiz entwickeln, wenn an ihnen der Raureif oder Frost haftet. Einige Arten unter den Insekten legen ihre Eier in die senkrechten Halme. Der Schlupf erfolgt im darauffolgenden Jahr. Ausgeblühte Gräser oder Distelblüten liefern in Herbst und Winter Sämereien für die Samenfresser unter den Vögeln wie der Stieglitz oder Distelfink, ein farbenprächtiger Singvogel. Andere Insekten überwintern unter der Baumrinde oder im Boden. Manche Arten verfügen sogar über eine Art „Frostschutzmittel“ wie der Zitronenfalter, der bis zu minus 20 Grad , an Efeu – oder Brombeerblättern hängend, den Winter übersteht.
Diversität anbieten
Ein einheitlich geschorener Rasen bietet wenig Abwechslung. Wie wäre es mit einer „Blühinsel“? Hier wird der Rasen abgeschoben, etwas Sand in den Oberboden gemischt und einheimische standortgerechte Saatgutmischung ausgesät (z.B. Kleinmengen bei www.wild-saat-gut.de). Zur besseren Erkennbarkeit und Vermittlung an Kinder oder Gäste sollte man den Bereich markieren („Vorsicht: Blühinsel“ o. ähnlich).
Feuchte Stellen unter Stauden kann man sich selbst überlassen, das Laub liefert eine gute Bodenabdeckung. Ein offener ungeschützter Boden trocknet weitaus schneller aus. Als Bodendecker an sonnigen, auch trockeneren Standorten sind auch Storchschnabelgewächse sinnvoll, da sie viele Insekten anlocken. Oftmals siedeln sich farbenprächtige Malven und auch Stockrosen an sonnigen Plätzen von selbst an. Freuen sie sich über den Neuzugang. Ein kleiner Sandhaufen, sonnenexponiert und an einer geschützten Stelle z.B. unter der Dachtraufe wirkt auf bodennistende Insekten mit nahezu magischer Anziehungskraft. Gerade aus Mangel an Strukturen, wie sie früher auf Sandwegen häufig beobachtet werden konnten, benötigen diese Arten sandigen Boden, um dort ihr Nest anzulegen. Auch hier ist eine Markierung sinnvoll, damit nicht der nächste Gartenaktive die „Kinderstube“ beseitigt.
Den Tisch decken für Insekten – Blühaspekte über das Jahr verteilen
Bereits im März ab 10 ° C sind die zu den Wildbienen gehörenden Hummeln unterwegs auf der Suche nach Nahrung. Hier hilft ein Angebot von Zwiebelgewächsen als Frühblüher Sortiment. Dazu gehören die weit geöffneten Blüten von Wildkrokus, Blaustern und weitere Arten. Auch Weiden liefern bereits früh im Jahr Pollen für Wildbienen. Eine gezielte Förderung von Wildbienen findet man auch unter www.wildbienen-futterpflanzen.de.
Die Blütezeit eines Faulbaumes reicht außerordentlich lange, ähnlich wie bei der Felsenbirne. Davon können Wildbienen profitieren, denn sie finden Nahrung zwischen Mai und Oktober. Besonders wichtig ist es, dass Insekten Pflanzen vorfinden, die zu ihren Mundwerkzeugen passen. Dies ist auch ein Grund, weshalb standortfremde, exotische Pflanzen und vor allem solche mit geschlossenen Blüten keinen Wert für unsere heimischen Wildbienen haben. Dagegen lädt die Hunds- oder Heckenrose mit ihren geöffneten Blüten Insekten auf einen Besuch ein.
Von besonderem Wert für Insekten sind Pflanzen mit kleinen Blüten, oftmals Wildkräuter, die in unserer Gartenlandschaft gern übersehen oder ausgerupft werden. Gerade an diese Kräuter sind die Mundwerkzeuge von Wildbienen angepasst. Dazu gehören beispielsweise Salbei, Nesseln, Glockenblume, Disteln, Phazelie, Lungenkraut und Ysop. Tagfalter saugen Nektar aus tiefen, langen Blütenröhren wie bei Ginster, Kardengewächsen, Rotklee, Wiesenflockenblume, Hornklee, Frühlingsplatterbse oder Nelkengewächsen.
Verzicht auf den Einsatz von Pestiziden
Wer es ernst meint mit einem naturnahen Garten benutzt keine Insektizide, denn die vorkommenden Insekten sind immer auch Nahrungsgrundlage für Vögel und auch Fledermäuse. Ameisen können Blattläuse zur Absonderung ihres süßen Zuckersaftes bewegen, indem sie sie mit ihren Antennen berühren. Als Gegenleistung bieten die Ameisen den Blattläusen Schutz vor deren Fressfeinden, denn sie verteidigen die Blattläuse. Im Tierreich nennt man diese Beziehung, die für jedermann einen Vorteil hat, eine Symbiose.
Blattläuse werden gern von Marienkäfern und auch von Ohrenkrabblern gefressen. Doch hier gilt es, nachzuzählen: hat der Käfer sieben Punkte auf den Deckflügeln, handelt es sich um den einheimischen Siebenpunktmarienkäfer. Die anderen Marienkäfer-Arten sollte man nicht fördern, denn sie können den angestammten Käfer verdrängen.
Wie man sich mit natürlichen Mitteln im Garten gegen pflanzenschädigende Insekten zur Wehr setzt, lässt sich leicht ermitteln (z.B. das Einsprühen mit Brennnesselbrühe uvm.).
Weitere Möglichkeiten
Es gibt weitere Möglichkeiten, einen Garten aufzuwerten. Beispielsweise lässt sich das Dach eines Carports oder einer Garage mit einem extensiven Gründach versehen. Nach Klärung der zulässigen Dachtraglast lassen sich hier Kräutermischungen für extreme, häufig trockene Standorte ausbringen. Die Mischungen sollten auch standorttypisch und regionsspezifisch ausgewählt werden. Sie sind über www.rieger-hofmann.de zu beziehen. Auch hier lässt sich ein bisschen mehr Diversität für Insekten anbieten z.B. durch kleine Holzstapel oder sandige Offenstellen, an denen sich bodennistende Arten Gänge graben können. Im Herbst sind aufkeimende Sämlinge z.B. des Haselstrauchs oder anderer Baum- und Straucharten herauszuziehen, damit die Folie langfristig nicht geschädigt wird. Eine Dachbegrünung hat auch einen klimatischen Nutzen, denn der Boden und die Pflanzen speichern Wasser. Dieses kühlt die Umgebung und wird nicht der Kanalisation zugeführt.
An einer sonnenexponierten Hauswand kann man Wein pflanzen und mittels Rankgittern hochwachsen lassen. Dabei bleibt die Hauswand verschont. Auch wilder Wein ist eine Möglichkeit, er haftet jedoch selbst an der Wand wie auch Efeu. Efeu gilt naturschutzfachlich als äußerst wertvoll. In dem dichten Blattwerk finden Vögel Nist- und Versteckmöglichkeiten. Efeu blüht spät im Jahr und bietet Insekten wertvolle Nahrung. Eine auch mehrfach blühende Pflanze ist das Waldgeißblatt, das mittels Rankgittern gut an einer Pergola wachsen kann. Es ist ein Vogelnährgehölz und bietet einen guten Nistplatz. Nachtfalter mögen das Waldgeißblatt besonders, damit sorgen sie für die Bestäubung.
Beleuchtung ja, aber insektenfreundlich
Um den Anflug von Insekten an nächtliche Beleuchtung zu vermeiden, ist eine niedrig angebrachte, warm-gelbe Lichtquelle aus sparsamen LED zu wählen. Die Farbtemperatur sollte maximal 2.700 bis 300 Kelvin nicht überschreiten. Näheres dazu: Insekten – was wir ihnen schulden .
Achtung: Vogelschlag – Maßnahmen gegen Vogelanflug an Fensterscheiben
Moderne Architektur weist häufig hochspiegelnde Glasfassaden auf, an denen Vögel durch Kollision zu Tode kommen (LAG VSW 2017, Steiof et al. 2017). Dabei bildet der hohe Reflexionsgrad von Scheiben (vor allem in unmittelbarer Nähe zu Vegetation) ein besonderes Problem: Isolierverglasung hat einen Reflexionsgrad von 15% und mehr, normales Glas zu etwa 8% (Steiof 2018). Problematisch ist insbesondere die sich spiegelnde nahe dem Gebäude stehende Vegetation, die von Vögeln zur Deckung und Nahrungssuche aufgesucht wird. Vor allem über- Eck angebrachte stehende Glasscheiben sind besonders gefährlich und zu vermeiden.
Eher für den gewerblichen Einsatz sind Muster auf den Fensterscheiben erhältlich. Dies können schwarze oder schwarz-orange Punkte, weiße Linien in unterschiedlichen Variationen oder quer verlaufende schwarze Streifen darstellen. Hersteller dieser Produkte sind auf der Internetseite der Schweizerischen Vogelwarte[2] abzurufen. Geätzte Gläser schützen zuverlässig vor Vogelanflug. Auch im hiesigen Handel gibt es Vogelschutzgläser.
Für den Privathaushalt ist es ausreichend, tagsüber mit Jalousien, Rollläden oder Gardinen den Reflexionsgrad der Verglasung zu reduzieren. Auch Mückenschutznetze und Streifenvorhänge erwiesen sich als wirksamer Schutz gegen Vogelschlag.
Greifvogelsilhouetten und UV-Folien zeigen keine Wirksamkeit gegenüber Vogelschlag und sind aus diesem Grund nicht zu empfehlen.
Weitere Quellen:
Schweizerische Vogelwarte Sempach & Wiener Umweltanwaltschaft (o.J.): Vögel und Glas. Aufgerufen am 10.06.2022, http://vogelglas.vogelwarte.ch/
Steiof, K., R. Altenkamp, K. Baganz (2017): Vogelschlag an Glasflächen: Schlagopfermonitoring im Land Berlin und Empfehlungen für künftige Erfassungen. Ber. Vogelschutz 53/54: 69-95.
Steiof, k. (2018): Es wird Zeit zu handeln: Vögel und Glas. Der Falke 5/2018, S. 25-31.
[1] https://link.springer.com/article/10.1007/s13165-020-00279-2
[2] https://vogelglas.vogelwarte.ch/assets/files/broschueren/voegel_glas_licht_2012.pdf
BENE stellt sein Verkehrskonzept 2030 für die Gemeinde Bad Essen vor
/in Aktuelles, Ideen, News, Politik in Bad Essen /von Eckhard EilersMitglieder von BENE haben am 30. September 2022 das “Verkehrskonzept Bad Essen” für die ganze Gemeinde im Rathaus vorgestellt. Die Lokalpresse berichtet heute auf der Online-Seite der Neuen Osnabrücker Zeitung. Ergänzende zu dieser Berichterstattung präsentieren wir hier eine Kurzfassung des Konzeptes mit Bildern aus der Präsentation.

Die Gemeinde Bad Essen umfasst 17 Ortschaften, die insbesondere im östlichen Bereich weit voneinander entfernt liegen. Hinzufügen möchte ich hier für den Bereich der Ortschaft Bad Essen den Ortsteil Essener Berg hinzufügen, der verwaltungsrechtlich zur Ortschaft gehört, jedoch durch seine Lage auch als eigener Wohnbereich gelten kann. Gleiches gilt für Harpenfeld mit seinem separaten Wohngebiet Himmelreich.
Eine Besonderheit bildet der Kirchplatz Bad Essen, der außer für Marktbeschicker, Lieferdienste und Gottesdienstbesucher von PKW, LKW und Motorräder nicht befahren werden darf.

Der nächste Bahnhof der DB befindet sich in Bohmte (nur Regionalverkehr). Der Bahnhof hat keinen behindertengerechten Zugang zu den Bahngleisen. Die nächstgelegenen Zugänge zum Fernverkehr befinden sich in Osnabrück (25 km), Diepholz (35 cm) und Bünde (ca. 30 km). Eine Busverbindung gibt es nur nach Osnabrück.
Das einspurige Gleis der ehemaligen Wittlager Kreisbahn führt von Bohmte Richtung Osten nach Bad Holzhausen und wird derzeit nur für Güterzüge genutzt. Fünf größere Betriebe liegen in fünf Ortschaften in der Nähe zum Gleiskörper. Zum Teil führt die Bahntrasse direkt durch das Betriebsgelände. Derzeit nutzt jedoch nur ein Betrieb regelmäßig die Bahnstrecke für die An- und Auslieferung von Rohstoffen und Waren (Agro).
Auf der Strecke von Bohmte bis Lintorf bestehen 6 kleine Haltstellen, teilweise sind diese mit höheren Zustiegsmöglichkeiten im Personenverkehr ausgestattet. Derzeit ist kein zugelassener, fahrplanmäßiger Personenverkehr möglich. Lediglich die Museumsbahn Minden und sehr selten Sonderfahrten nutzten die Gleise maximal 10 mal im Jahr.

Im BENE-Verkehrskonzept 2030 bildet die Reaktivierung dieser Verbindung zwischen den Großräumen, Bremen, Osnabrück, Bünde, Herford und Bielefeld das Rückgrat des zukünftigen Verkehrs in der Gemeinde Bad Essen und darüber hinaus im Wittlager Land. Dabei fungieren die Haltestellen Wehrendorf, Bad Essen-Bahnhof, Wittlage, Rabber und Lintorf als Knotenpunkte, die den Übergang zwischen Fußgänger*innen, Radfahrer*innen, ÖPNV, KFZ-Fahrer*innen und weiteren Verkehrsteilnehmenden darstellen und verknüpfen. Im Folgenden werden sechs Gebiete der Gemeinde als „Verbundzonen mit Knotenpunkt“ bezeichnet.
Die Ausstattung der Knotenpunkte muss mindestens zwei Bushaltestellen, sichere und überdachte Fahrradabstell- und Abschließmöglichkeiten, eine begrenzte Anzahl an PKW-Parkplätzen sowie barrierefreie Zugänge zu allen Ressourcen des Knotenpunktes umfassen.

Neben den Fußgänger*innen bilden die Radfahrer*innen die Gruppe, die – abgesehen von der Wärmeversorgung – den höchsten Beitrag zur Einsparung von Energie und damit von Treibhausgasen erzielen können. Für ein zukunftsfähiges Verkehrskonzept benötigen wir den Abbau der Privilegierung des motorisierten Individualverkehrs und eine über Jahre gehende Förderung der CO2-freien Bewegungsformen mit den entsprechenden Flächen. Das gilt auch für die Mitten der Ortschaften. Dafür müssen an allen Bundes-, Landes,-Kreis- und Gemeindestraßen sichere Radfahr- und Fußgängerweg angelegt werden, die entweder zwei Fahrspuren haben oder beidseitig der jeweiligen Straße einspurig verlaufen. Dies gilt für Straßen, die eine Verbindungsfunktion zwischen den Ortschaften haben. Weiterhin soll ein Radfernweg entlang des Mittellandkanals für Radfahrer*innen verkehrstauglich hergerichtet werden. Zusätzlich sollen Radwege in das Gebiet der Gemeinde als auch zu Zielen außerhalb der Gemeinde führen (Radschnell-/Fernwege).
Nebenbemerkung: Auch der Mittellandkanal ist ein Verkehrsweg, der neben dem Güter- und Privatbootsverkehr auch den Personenverkehr zulässt.
Der Bus- und Schnellbusverkehr muss auf die Bedürfnisse aller Bürger*innen ausgerichtet werden – und das nicht nur in Schulzeiten. Wir schlagen deshalb neben den bestehenden und auf die Bedürfnisse der Bevölkerung neue auszurichtenden Busverkehr dieSchaffung einer Schnellbuslinie von Pr. Oldendorf (mit schneller Umstiegsmöglichkeit) über die Knotenpunkte in der Gemeinde Bad Essen und Leckermühle (ggfls. mit dem Bahnhalt Ostercappeln) nach Osnabrück vor.

Um Ihnen die Teilhabe am Gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen und zu erleichtern, haben wir uns etwas Besonderes überlegt: Das Projekt „Bürger-Bus“.
Ein „Bürger-Bus“ ist optimalerweise ein E-Auto mit max. 8 Fahrgastplätzen und einem Fahrer*in-Platz. Der Bürger-Bus kann bei Bedarf alle Bürger*innen transportieren (und ggfls. begleiten), die auf ein eigenes Auto verzichten wollen oder müssen. Viele weitere Gelegenheiten, einen Bürger-Bus für die Dorfgemeinschaft zu nutzen, sind denkbar.
Ein Bürger-Bus sollte in jeder Ortschaft stationiert werden.
Schlussbemerkungen
- Die Erfahrung von Verkehrsplanern im europäischen Ausland zeigen, dass Alternativen zum bisherigen PKW- und Lastenverkehr erst dann von der Bevölkerung angenommen werden, wenn die entsprechenden Angebote eingerichtet sind.
(siehe auch: https://www.ardmediathek.de/video/arte/wie-gelingt-die-verkehrswende/arte/Y3JpZDovL2FydGUudHYvdmlkZW9zLzA5NjI4MC0wMDAtQQ) - Einig sind sich alle Verkehrsplaner, dass die Verkehrsflächen für Fußgänger*innen und Radfahrer*innen vergrößert werden müssen, um dem zukünftigen Verkehrsaufkommen gerecht zu werden und um die Sicherheit auf diesen Wegen deutlich zu erhöhen.
- Um die Klimaziele der Gemeinde Bad Essen (siehe Integriertes Klimaschutzkonzept) zu erreichen, muss der vorhandener Straßenraum für alle Mobilitätsformen nach unserer Überzeugung gerechter aufgeteilt werden – und zwar deutlicher, als es im Klimaschutzkonzept beschrieben ist.
- Innerörtliche Flächen, die vom motorisierten Verkehr „befreit“ sind, erhöhen die Aufenthaltsqualität von Gästen, aber auch von allen Bewohner*innen.
- Alle Bürger*innen haben einen Anspruch auf Mobilität. Deshalb wollen wir den „Bürger-Bus“ für alle Ortschaften einführen, der allen Bürger*innen die Möglichkeit zur Teilnahme am öffentlichen Leben ermöglicht. Der „Bürger-Bus“ soll in jeder Ortschaft installiert und von der Dorfgemeinschaft organisiert werden. Der Einsatz reicht von den Kindergartenfahrten über Einkauffahrten für Senior*innen bis zu begleiteten Tür-zu-Tür-Fahrten (z.B. Arztbesuch, Teilnahme an Veranstaltungen). Der Bürgerbus kann beispielsweise auch für größere Besorgungen oder für Ausflüge genutzt werden.
Eine zusammenfassende pdf-Version des Verkehrskonzeptes kann hier geöffnet bzw. heruntergeladen werden: BENE_Verkehr_statisch
Eine Video-Version der Präsentation kann hier heruntergeladen werden.
Insekten sichern unsere Lebensgrundlagen!
/in Aktuelles, Allgemein, Best practice, News /von Eckhard EilersWas wir ihnen schuldig sind
von Dr. Birgit ten Thoren, Bad Essen
Zum Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen gehören auch in besonderem Maße Insekten. In Deutschland sind 26,2 Prozent von knapp 6.750 neu bewerteten Insektenarten in ihrem Bestand gefährdet. Das ist die Bilanz der jetzt vom Bundesamt für Naturschutz (BfN) veröffentlichten Roten Liste zu den wirbellosen Tieren [1].
Dramatische Einbrüche in der gesamten Insektenmasse in den letzten Jahrzehnten sollten nicht nur aufhorchen lassen, sondern mahnen dringend Maßnahmen gegen weitere Verluste an.
Warum fehlen heute viele Insekten?

Die Gründe für das Insektensterben sind vielfältig: Der größte Anteil mit knapp 47% weltweit geht auf die Intensivierung der Landwirtschaft und den Einsatz von Pestiziden und Düngemitteln zurück (Abb. 1; Sanchez-Bayo & Wyckhuys 2019).
Weitere Faktoren liegen im Verlust von Lebensräumen (durch Urbanisierung, Entwaldung und Veränderung von Flüssen und Feuchtgebieten) sowie in biologischen Faktoren (durch fremde Arten oder Krankheitserreger) und dem Klimawandel sowie unbekannten Faktoren begründet (Sanchez-Bayo & Wyckhuys 2019)[2].
Abbildung 1: Ursachen für das Insektensterben nach Sanchez-Bayo & Wyckhuys (2019)
Einer der entscheidenden Faktoren für den Verlust an geeignetem Lebensraum ist der hohe Stickstoffeintrag in die Umwelt, der über verschiedene Wege, wie durch Mineraldünger, Verbrennungsprozesse, stickstoffbindende Ackerpflanzen in die Umwelt gelangt und zur Eutrophierung (Nährstoffübersättigung) führt [3]. Die Folgen dieser hohen Stickstoffbelastung wirken nachteilig auf die Biodiversität, das Bodenleben, das Grundwasser und die Oberflächengewässer, letztlich auch auf das Klima und die menschliche Gesundheit [4].
Bezogen auf die Biodiversität zeigt sich der Stickstoffüberschuss an einem Schwund an stickstoffsensiblen Pflanzenarten, denn diese werden von unempfindlichen Pflanzenarten und ihrem gesteigerten Wachstum überdeckt. So führt die Eutrophierung seit Jahren verstärkt zu einem nahezu lückenlosen Bewuchs aus Gräsern. Magere Standorte mit Margerite, Wiesen-Bocksbart, Heidenelke und andere Kräuter der Wiesen und Magerrasen finden im intensiv genutzten Wirtschaftsgrünland keinen Platz mehr5. Sie weichen vor dem Überangebot an Düngung auf die mageren Standorte aus und verschwinden auch dort, wenn hier das Gräserwachstum ungebremst die Vegetationsdecke dominiert. Dieser Prozess wird leider durch die Praxis des Mulchens, bei dem das Mahdgut liegenbleibt (Abb. 2), noch verstärkt. Es profitieren nur die Gräser, denn unter der Decke des düngenden Schnittguts werden viele Blütenpflanzen im Keim erstickt.

Abbildung 2: Mulchen von Randstreifen verhindert den Aufwuchs von Blütenpflanzen (Foto: B. ten Thoren)
Wie auch in ihren Ansprüchen hochspezialisierte Pflanzenarten haben auch viele Insektenarten spezifische Ansprüche an magere Standorte und deren natürlichem Bewuchs mit spezialisierten Pflanzenarten. Im Zuge der nahezu lückenlosen Landschaftsnutzung im Verbund mit der Eutrophierung sind die mageren Standorte mittlerweile großräumig zur Mangelware geworden.
Die besonderen und unentgeltlichen Leistungen von Insekten
In einer Studie zur Bestäubung fanden Wissenschaftler der Universität Hohenheim heraus, dass die Bestäubungsleistung von Insekten allein in Deutschland etwa 3.8 Milliarden Euro pro Jahr entspricht („Die ZEIT“, 4.03.20216). Allein der Ertrag bei Äpfeln und Birnen lässt sich zu zwei Dritteln auf die Bestäubungsleistung von Insekten zurückführen. Das gilt für die meisten Obst- und Gemüsesorten und nicht minder für die Küchenkräuter, mit denen wir unsere Gerichte verfeinern7. Dabei sollte besonders betont werden, dass diese Leistungen dem Menschen quasi „zur Verfügung“ gestellt werden und der Mensch Nutznießer ist.
Bei ihrer Nahrungssuche von Nektar und Pollen bestäuben die Insekten das weibliche Blütenorgan mit den Pollen, die von anderen Blütenbesuchen an ihnen haften. Allein dieser Vorgang sichert weltweit etwa 88% der geschlechtlichen Vermehrung von Pflanzen. Die überwiegende Bestäubung erfolgt dabei durch Insekten, obwohl auch Fledermäuse und Vögel zu einem kleinen Anteil dazu beitragen.
In besonders großem Maße sind Wildbienen und Schwebfliegen an der Bestäubung von Pflanzen beteiligt (Abb. 3). Nach einer englischen Untersuchung (Breeze et al. 2011; siehe FiBL 2016) leisten Honigbienen etwa maximal ein Drittel der gesamten Bestäubung [8]. Zudem konnte nachgewiesen werden, dass Honigbienen die Bestäubungsleistung von Wildbienen lediglich ergänzen, jedoch nicht ersetzen können (siehe Artikel: FiBL 2016; Garibaldi et al.2013).

Abbildung 3: Nur bei genauem Hinsehen sieht man die Wildbiene in der Storchschnabelblüte (Fotos: B. ten Thoren)
Gemessen an dieser enormen ökosystemaren Leistung, die Wildbienen, Schwebfliegen und andere Insekten liefern, ist der Mensch es ihnen schuldig, ihnen Lebensräume zu belassen, neu anzubieten und diesen fleißigen Helfern Schutz zu gewährleisten. Dabei trägt eine nachhaltige, agrarökologische Landwirtschaft nachweislich zur Erhaltung der Wildbienen bei (FiBL 20168). So ist es nicht nur aus Sicht des Naturschutzes wichtig, für den Erhalt von Wildbienenlebensräumen einzutreten, sondern insbesondere auch aus Sicht der Landwirtschaft.
Wie können wir Insekten schützen?
Zum Schutz von Insekten hat der Erhalt von Wildbienenlebensräumen Priorität [9]. Dazu gehören ihre artspezifischen Nahrungsquellen und ihre Nistplätze10 einschließlich der notwendigen Baumaterialien und eine deutliche Verringerung ihrer Gefährdungsfaktoren.
Gefährdungen: nächtliche Lichtquellen als Insektenfalle
Zu den einfach umzusetzenden Maßnahmen zählt die Neugestaltung und Umrüstung von Beleuchtungsanlagen, um dem „Staubsaugereffekt“ herkömmlicher, insektenanlockender Beleuchtung zu begegnen. Das Dunkel der Nacht ist durch die Urbanisierung, aber auch durch den Wunsch nach Helligkeit im Bewegungsraum des Menschen in vielen Bereichen verschwunden, nicht ohne Folgen für Mensch und Tier.
Während der Mensch ultraviolettes Licht nicht wahrnimmt, gilt das nicht für einige Insekten (Schroer et al. 2019)11. Viele Insektenarten können kurzwellige Lichtstrahlen wie UV-Licht und hohe Blaulichtanteile wahrnehmen und werden stark angelockt. Es gilt also, bei der Wahl der Beleuchtung diejenigen Wellenlängen möglichst zu minimieren, die eine anziehende Wirkung auf Insekten haben. Diese Wirkung gilt hauptsächlich während der Vegetationsperiode zwischen März und Oktober.
Dort, wo die Farberkennung für den Menschen nicht so wichtig ist bzw. war wie in Gewerbegebieten, z.B. Häfen, wurden Natriumdampflampen eingesetzt. Dabei gelten Natriumdampfniederdrucklampen als eine der energiesparsamsten und insektenfreundlichsten Beleuchtungsanlagen (Hänel12), zudem mit hoher Lebensdauer, allerdings schlechter Farbwiedergabe (Huggins & Schlacke 201913).
Heute greift man auf ein schier unübersichtliches Angebot an LED zurück, die das nächtliche Farbsehen für den Menschen gewährleisten. Jedoch erfüllen sie nicht immer die Standards, die zum Schutz von Insekten gelten. Grundsätzlich ist die Anlockwirkung auf Insekten umso größer, je heller die emittierende Lichtquelle ist, je höher sie angebracht ist und je näher sie an den Lebensräumen von Insekten liegt (Huggins & Schlacke 201913.
Beleuchtung: soviel wie nötig, sowenig wie möglich.
Der Leuchtmittelpunkt sollte so niedrig wie möglich gewählt werden, die Strahlungsrichtung auf den Boden begrenzt werden (Schroer et al. 2019). Um auch bei den LED`s die Anlockwirkung auf Insekten weitestgehend zu reduzieren, wird seitens der Forschung empfohlen, einer Farbtemperatur von 2.700 bzw. 3000 Kelvin zu wählen (Huggins & Schlacke 2019 13, Schroer et al. 2019). Dieses entspricht einem warm-gelben Lichtton, der Insekten wenig anlockt.
Was Insekten brauchen: Nistplatz, Baumaterial und Nahrungsangebot
Entscheidend ist für viele Insekten ein kontinuierliches Blütenangebot, da bei vielen, nicht staatenbildenden Arten die Flugzeit nur ein bis zwei Monate andauert. Staatenbildende Insekten wie die Hummeln benötigen ein Blütenangebot von März bis Oktober (FiBL 20167). Unter Berücksichtigung des geringen Flugradius liegen Nistplätze (Abb. 4, 5 a-c), Baumaterial und Nahrungsplätze (Abb. 6a,b) in geringer Entfernung zueinander.

Abbildung 4: Lebensraum einer Wildbiene (Quelle: www.wildbienen.info)



Abbildung 5 a-c:
Beispiele für Insektenlebensräume
(Fotos: B. ten Thoren)
Lebensräume für Insekten durch Flächenschutz und Biotopvernetzung
Naturschutzgebiete können Lebensräume sichern und einen Beitrag zur Rettung der Artenvielfalt leisten. Darüber hinaus ist jedoch auch ein geeigneter Biotopverbund wichtig, um die Ausbreitung wenig mobiler Arten zu sichern.
In der freien Landschaft, vor allem in der Agrarlandschaft gilt es, strukturelle Vielfalt zu erhalten und Lebensräume für Insekten zu fördern. Ebenso ist dies ein wichtiger Auftrag für Kommunen, die über die Gestaltung der öffentlichen Räume, wie Schulen und Parks, sowie auch Siedlungen entscheiden9. Letztlich ist jeder Gartenbesitzer aufgefordert, sich seinem Grundstück für das Wohl der Insekten einzusetzen.
Wegränder und Saumbiotope
Wegränder und Saumbiotope lassen sich ohne großen Aufwand als wertvoller Insektenlebensraum gestalten. Ein ideales Saumbiotop kann als Lebens- und Rückzugsraum ca. 1.000 Pflanzenarten und ebenso vielen Tierarten5 Lebensraum bieten. Für viele Arten ist es ein wichtiges Ersatzhabitat, wenn ihr eigentlicher Lebensraum, ursprünglich extensive Wiesen oder sanddominierte Magerstandorte, nicht mehr zur Verfügung steht.

 Abbildung 6a und b:
Abbildung 6a und b:
Saumhabitate mit Malve
und Wegwarte
(Fotos B. ten Thoren)
Wegränder mit einer gewissen Mindestbreite können dem Insektenschutz dienen, wenn sie dauerhaft der Düngung entzogen werden, keine Behandlung mit Pflanzenschutzmitteln erfolgt, sie nicht oder nur extensiv genutzt und extensiv gepflegt werden.
So können Wegraine und Saumhabitate überlebenswichtige Ersatzhabitate für die Pflanzen- und Tierarten sein, die auf der Flucht vor einem Überangebot an Nährstoffen ihren Ursprungslebensraum verlassen (LANUV, Infoblätter 39).
Tipps für Gartenbesitzer: Weniger ist mehr
Von besonderer Bedeutung für die Artenvielfalt sind Bereiche im Garten, die ungenutzt bleiben, nicht geräumt oder gepflegt werden. Nur dort, wo der Mensch wenig oder nicht eingreift, kann sich Leben entwickeln. Wer in seinem Garten sich entwickelndes tierisches Leben findet und es toleriert, wird durch interessante Beobachtungen belohnt. Denn der Mensch fühlt sich nachweislich dort wohl, wo sich auch natürliches Leben abspielt, sei es durch Blüten besuchende Hummeln, durch die singende Mönchsgrasmücke oder einen Molch im Gartenteich.
Eine gewisse Unordnung sollte man tolerieren, Totholzbereiche liegen und/oder stehen lassen oder sogar aufstapeln und Insekten zur Überwinterung bzw. als Nistplatz anbieten.
Stängel ausgeblühter Stauden sollte man über den Winter stehenlassen, denn in den Stängeln können Insekten ihren Nachwuchs überwintern lassen. Beispielsweise überwintern in Schilfstängeln die Blattlausjäger Marienkäfer und die Florfliege. Forscher konnten in Schilfhalmen in einem Knotenabschnitt bis zu sechs Larven finden (NABU Bremen, Gartentipps).
Das liegen gelassene Laub auf den Beeten oder eine dünn ausgebrachte Schicht mit Rasenschnitt ist ein guter Schutz gegen Austrocknung des Bodens und liefert bei ausreichender Feuchtigkeit durch natürliche Zersetzung den Humus. Vor allem im Laub verstecken sich Kleintiere, die vielen Vögeln in der Winterzeit als Nahrung dienen.
Neben offenblütigen Pflanzen wie z.B. den Glockenblumen oder Wildrosen eignen sich vor allem auch Gartenkräuter als Insektennahrung: wie z.B. Rosmarin, Salbei, Oregano, Thymian, Schnittlauch, Minze, Zitronenmelisse (Abb. 7, 8).


Abbildung 7: Schwebfliege an Glockenblume und Abbildung 8: Malve, Kräuter und sandige Bodenstellen als Insektenrefugium (Fotos: B. ten Thoren)
Sie tun den Insekten Gutes, wenn Sie auf den Mähroboter verzichten und Gartenbereiche extensivieren, nicht mehr düngen und den Rasen teilweise länger stehenlassen. Es entwickelt sich quasi von selbst eine Fläche mit verschiedenen Kräutern, die wie z.B. auch der Klee, Ehrenpreis, Günsel und Gundermann von Wildbienen angeflogen werden. Die Aussaat einer geeigneten Wildblumenmischung an einer Stelle im Garten sollte gut überlegt und nur mit Material aus einem Fachbetrieb vorgenommen werden. Nicht geeignete Samenmischungen führen nicht zwangsläufig zum Erfolg. Man sollte jedoch nur standortheimisches Saatgut anwenden. Im Landkreis Osnabrück gibt es beispielsweise die an der Hochschule entwickelte „Osnabrücker Mischung“.
Worauf es im Garten ankommt
Neben einem bunten, dauerhaften Blütenangebot von ein- und mehrjährigen Stauden sollte das biodiversitätsfördernde Vegetationsangebot im Garten im Wesentlichen einheimische, vor allem standortheimische Sträucher und Bäume umfassen. Empfehlenswert sind Sträucher wie z.B.: Liguster, Buche, Hainbuche, Haselnuss, Weiß- und Schwarzdorn, Schlehe, Pfaffenhütchen, Holunder, Faulbaum, Felsenbirne, Schneeball und Kornelkirsche. Bäume spenden nicht nur Schatten und sorgen für ein angenehmes (Klein-)klima, sie liefern auch wertvollen Lebensraum. Bei der Wahl sind heimische Arten zu bevorzugen, weil sie den deutlich größeren Beitrag zur Biodiversität liefern. Einzelgehölze wie z.B. Obstbäume, Eiche, Buche, Hainbuche, Feldahorn, Linde und Birke können Lebensraum für viele -zig Tausende Tierindividuen bieten. So leben allein auf einer alten Eiche bis zu 1 Million Insektenindividuen, während eine Birke auf „nur“ 200.00 kommt.
Eine besondere bereichernde und klimatisch günstige Bedeutung hat auch eine insektenfreundliche Fassadenbegrünung durch Rankklimmer wie Waldgeißblatt (Abb. 9), Hopfen und Waldrebe. Sie benötigen ein Gitter, um sich daran hoch zu entwickeln. Kletterhortensie (Abb. 10), Wilder Wein und Efeu, das ein wichtiges Nährgehölz für Insekten und Refugium für Vögel darstellt, haften dagegen mit Saugnäpfen unmittelbar an der Wand.


Abbildung 9 und 10: Waldgeißblatt und Kletterhortensie liefern eine ansehnliche Insektenweide mit lang dauerndem Blühzeitraum (Foto: B. ten Thoren)
Gemeinden: Positiver Nebeneffekt naturnaher Flächen
Eine anschauliche und breit angelegte Orientierungshilfe für „Insektenschutz in der Kommune“ liefert das Bundesamt für Naturschutz gemeinsam mit dem Deutschen Städte und Gemeindebund (BfN & DStGB 2020: DOKUMENTATION NO 155). Neben der naturschutzfachlichen Bedeutung des Insektenschutzes werden eine Reihe von Beispielen zur Biodiversitätsstrategie in Städten und zum Wildbienenschutz aufgeführt.
Eine standortheimische Bepflanzung liefert neben einem guten Angebot an Nektarquellen und Nistplätzen für die Artenvielfalt auch eine nicht unerhebliche positive klimatische Wirkung. In der o.g. Dokumentation wird über die Notwendigkeit von Insektenschutzmaßnahmen hinaus auch auf den klimatologisch günstigen Effekt naturnaher Flächen hingewiesen. Eine naturnahe Flächengestaltung hilft, große Mengen an Wasser aufzunehmen und durch Verdunstung erst langsam wieder abzugeben. Die Folge ist ein luftbefeuchtender, kühlender Effekt und eine Verringerung des Hitzestaus in stark versiegelten Zonen und Wohnsiedlungen mit wenig Gartengrün oder hohem Versiegelungsgrad.
Insbesondere Bäume sind wahre Klimakünstler: Sie haben eine hohe Kühlleistung aufgrund einer starken Verdunstung, sie bieten Schatten und beherbergen – wenn sie alt und standortheimisch sind – Lebensraum für unzählige Insekten, Vögel und weitere Arten.
Bei allem wertvollen privaten Einsatz auf dem eigenen Grund ist die biodiversitätsfördernde Wirkung in Gemeinden und Gärten auf kleine Räume beschränkt und kann den tiefgreifenden Verlust in der freien Landschaft nicht ausgleichen. Dieser umfangreichen, schadvollen Entwicklung entgegenzuwirken, bedarf es politischer Instrumente.
Daher braucht es Geduld, guten Willen und Menschen, die mit Engagement und Überzeugungskraft eine Vorreiterrolle bei dem Einsatz für die Artenvielfalt übernehmen – in der Hoffnung, dass er breitere Akzeptanz und viele Nachahmer findet.
Denn, so die Süddeutsche Zeitung (15.05.2017): „Menschen fühlen sich nicht wohl, wenn sie von der Natur abgeschnitten sind“. Und: “Wenn die Insekten verschwinden, verschwindet auch die menschliche Zivilisation“ (Autor Andreas Weber im Dlf 2.04.2018).
Quellen/Literatur
2 Sanchez-Bayo & Wyckhuys, Biological Conservation 2019
3 Schaap et al (2018): PINET-3: Modellierung und Kartierung atmosphärischer Stoffeinträge von 2000 bis 2015 zur Bewertung der ökosystem-spezifischen Gefährdung von Biodiversität in Deutschland (letzter Aufruf 21.06.2021)
4 https://www.oeko.de/fileadmin/oekodoc/Instrumente-und-Massnahmen-zur-Reduktion-der-
Stickstoffueberschuesse.pdf (aufgerufen 21.06.2022)
5 https://www.lanuv.nrw.de/fileadmin/lanuvpubl/1_infoblaetter/info39_Broschuere_Wegrain.pdf
6 https://www.zeit.de/news/2021-03/04/studie-bestaeubungsleistung-von-insekten-ist-milliarden- wert?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
7 https://www.deutschland-summt.de/veranstaltungen-leser/wildbienen-in-unseren-gaerten-kurs-2-teil-1- 2.html
8 Forschungsinstitut für biologischen Landbau FiBL (2016): Wildbienen und Bestäubung. Darin: (Breeze, T.D., Bailey A.P., K.G. Balcombe & S.G. Potts (2011): Pollination services in the UK: How important are honeybees? Agriculture, Ecosystems & Environment 142 (137 – 143). (letzter Aufruf 21.06.2022)
9 file:///C:/Users/btent/Downloads/Aktionsprogramm_Insektenvielfalt_Niedersachsen_MU-2020.pdf (aufgerufen am 22.06.2022)
10 www.wildbieneninfo.de
11 Schroer, S., B. Huggins. M. Böttcher und F. Hölker (2019): Leitfaden zur Neugestaltung und Umrüstung von Außenbeleuchtungsanlagen. BfN Skripten 543
12 Andreas Hänel (18.06.2022) Vortrag: Schutz der Nacht. Tagung des Naturwissenschaftlichen Vereins Osnabrück
13 Huggins, B. & S. Schlacke (2019): Schutz von Arten vor Glas und Licht. Springer Verlag.
14 Bundesamt für Naturschutz und Deutscher Städte- und Gemeindebund (2020): Insektenschutz in der Kommune. Dokumentation No. 155)
Öffentliches ZOOM-Meeting!
/in Aktuelles, Allgemein /von Eckhard EilersBENE lädt erstmals zu einem öffentlichen ZOOM-Meeting ein! Das nächste Plenumstreffen am Mittwoch, 23.02.2022 um 19.00 Uhr, wird wieder online stattfinden. Neu ist, dass wir dieses Meeting auf der ZOOM-Plattform erstmals öffentlich durchführen. Alle Bürger:innen der Gemeinde Bad Essen sind eingeladen, sich einzuloggen und dabei zu sein. Das Treffen beginnt um 19.00 Uhr und wird etwa zwei Stunden dauern. Der Zugang zum Treffen wird 15 Minuten vor dem offiziellen Beginn zur Verfügung stehen.
Hier sind die Zugangsdaten:
https://us06web.zoom.us/j/82839509415?pwd=NjIzSWRYTkMzbkdPRVlDaFhVRlBwUT09
Meeting-ID: 828 3950 9415
Kenncode: 677179
Auf der Themenliste stehen beim Treffen am 23.02.2022 unter anderem Berichte der Arbeitsgruppen „Pflanzkisten“ und „Verkehr“ sowie weitere Aktionen.
Hinweis: Wir beraten in einem freundlichen und zugewandten Umgangston – auch mit Unterschieden in unseren Meinungen. Rassistische und sexistische Meinungsäußerungen werden nicht geduldet und können zum Ausschluss vom Online-Treffen führen.
Hauptmenü
Schlagwörter
Aktuelle Beiträge
- Fünf Themenschwerpunkte festgelegt 12. April 2024
- Obstbaumschnitt auf Peter-Rickmers-Wiese 10. Februar 2024
- Vortrag: Wildbienen und der Bau von Nisthilfen für Insekten 1. Februar 2024
- Bad Essen lädt ein: Wie kann kommunale Nachhaltigkeit in der Gemeinde gelingen 13. Januar 2024
- Angebot auf dem Bad Essener Wochenmarkt: Die Moorkiefer als ökologischer Weihnachtsbaum 27. November 2023